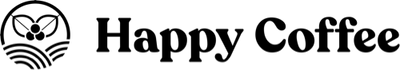Fairmondo wurde 2012 unter den Namen „Fairnopoly“ gegründet. Mit dem Slogan „Dreh das Spiel um“ wollte man endlich ein Marktplatz für alle sein, denen verantwortungsvoller Konsum und transparenter Handel wichtig ist. Was und wer steckt eigentlich hinter der Online-Plattform, die zum Angriff auf Ebay und Amazon bläst? Und wie hat sich das Unternehmen entwickelt?
Aktueller Hinweis (Stand Juli 2025): Nach unserer Recherche hat Fairmondo inzwischen Insolvenz angemeldet. Ein entsprechender Löschungseintrag der Firma findet sich im Handelsregister, und auch die alte Fairmondo Website ist inzwischen nicht mehr online. Zudem wies uns ein aufmerksamer Leser darauf hin, dass (Zitat) „(…) Genossenschaftsmitglieder um ihr zur Verfügung gestelltes Geld gebracht wurden.“ Die folgenden Schilderungen beziehen sich auf die Historie von Fairmondo bis 2024 – inzwischen gilt das Projekt als leider gescheitert.
1. Ansporn zur Gründung von Fairmondo: Negatives über Amazon
„Amazon gängelt Mitarbeiter wie vor 110 Jahren.“ Über Schlagzeilen wie diese aus der WELT Online vom 24. März. durfte sich Felix Weth fast schon freuen. Ursprünglich waren es genau diese Negativ-Schlagzeilen über den Online-Versandhändler, die den Gründer antrieben. Und auf die Idee brachte, einen fairen und transparenten Online-Marktplatz ins Leben zu rufen, der sich gegen die Übermacht Amazons sowie Ebays wehren will. Seit September 2013 bis 2024 war der alternative Versandhandel online – mit einigen Turbulenzen und den Auf und Abs, die für StartUps so typisch sind.
Im Dezember 2012 begann die Story von Fairmondo, damals noch unter dem Namen Fairnopoly. Felix Weth und Gleichgesinnte wollten gemeinsam eine faire Alternative zu den etablierten Marktplätzen Ebay und Amazon schaffen. Fair auf allen Ebenen sollte es dabei zugehen: Zum einen werden Anbieter von Produkten bevorzugt, die nach sozialen oder ökologischen Kriterien hergestellt wurden; zum anderen sollen dort faire Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter herrschen.
2. Durch Crowdfunding von der Idee zum Social StartUp
Als Felix Weth die Idee hatte, einen fairen Online-Marktplatz zu gründen, hatte er gerade erst seinen Magister in Politik, Philosophie und VWL von der Uni Tübingen in der Tasche. Trotzdem hatte er bereits ein paar praktische Erfahrungen gesammelt, darunter bei der GTZ (Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit) und bei Transparency International. Dort wurde auch sein Interesse im Kampf gegen undurchsichtiges Handeln, Korruption und illegale Absprachen geweckt. Von der Idee bis zur Umsetzung dauerte es nicht lange.
Durch Crowdfunding wurde mit 200.000 Euro das doppelte des anvisierten Ziels erreicht. Damit konnten die Vorlaufkosten wie Markenregistrierung, Anwaltskosten oder Designerhonorare gedeckt werden, bevor es an die Entwicklung des Genossenschaftsmodells zur weiteren Finanzierung ging. Seit dem Start des Projekts Fairmondo wuchs das Team um Unternehmensgründer und Ideengeber Felix Weth schnell. Über 20 Personen waren bei der Plattform angestellt. Darunter sogar eine Genossenschaftsmanagerin, die sich um die Betreuung der Mitglieder kümmerte.

Photo by Fairmondo / Fairnopoly
3. Fairmondo als Genossenschaft 2.0
Die Rechtsform der Genossenschaft ist für ein StartUp – und gerade für ein Tech-StartUp – eher ungewöhnlich. Doch der Genossenschaftsgedanke passte perfekt zum Ansatz eines fairen Unternehmens, bei dem nicht wenige große, sondern viele kleine Gesellschafter den Unternehmenskurs beeinflussen können.
Kleingesellschafter statt Entscheidungsmonopole
Der Zugang zur Genossenschaft war so geregelt, dass man auch schon mit einem kleinen Betrag Anteile erwerben konnte. Mit einem Mindesteinsatz von 50 Euro durfte man Mitglied werden und das bedeutete theoretisch auch, am Kurs des Unternehmens aktiv mitzuwirken. Um möglichst fair zu bleiben, musste natürlich auch sichergestellt sein, dass sich niemand ein Entscheidungsmonopol einkauft. Deshalb war bei 10.000 Euro Investmentsumme Schluss – nur bis zu diesem Wert konnte man sich Anteile sichern. Bis August 2017 hatten sich schon über 2.000 Genossen in die Online-Plattform eingekauft.
Denkst du, dass „Genossenschaft“ irgendwie oll klingt? Und ruft dieser Name bei dir Assoziationen wie Volksbanken oder im günstigsten Fall noch die taz wach? Wer ein antiquiertes, verklärtes oder weltverbesserisches Modell im Kopf hat, dem hatte Fairmondo etwas entgegenzusetzen.
„Mit Genossenschaft 2.0 bezeichnen wir das Ergebnis unseres Versuchs, ein konsequent faires und zugleich wirtschaftlich tragfähiges Unternehmensmodell zu entwickeln.“
So wurde das neue Verständnis einer „coolen“ Genossenschaft auf der ehemaligen Fairnopoly-Website dargelegt. Und man wollte auch „(…) zeigen, dass sich die Rechtsform der eingetragenen Genossenschaft durchaus für dynamische Internet-Unternehmen eignet.“ Ein mutiger Plan!
Wie Fairmondo sein Geld verdiente
Dass sich auch ein fairer Marktplatz finanzieren muss und Geld erwirtschaften will, ist somit schon mal klargestellt. Neben den Genossenschaftsanteilen waren es die Gebühren auf verkaufte Artikel, mit denen Fairmondo Geld einnahm. Bei diesem Modell hatte man sich zwar von der Konkurrenz inspirieren lassen. Doch auch hier bemühte man sich um Verhältnismäßigkeit. Während private Verkäufer z.B. auf Ebay bis zu 75 Euro an Gebühren abdrücken müssen, war die obere Grenze an Abgaben bei Fairmondo auf 30 Euro fixiert. Bei fairen Produkten wurde sie sogar auf 15 Euro gedeckelt. Und um auf Fairmondo Produkte anzubieten oder etwas zu kaufen, musste man kein Genossenschaftsmitglied sein. Wie bei der Konkurrenz genügte es, sich ein Profil anzulegen.
4. Faire Produkte auf Fairmondo: Passt die Xbox ins Konzept?!
Wir waren direkt zu Beginn, 2014, einen ersten Blick auf die Produktpalette des Online-Marktplatzes. Tatsächlich schien man sich zu bemühen, hauptsächlich nach fairen Kriterien hergestellte Produkte anzubieten. So bliebt z.B. die Suche nach Kleidung von H&M oder Zara – Firmen, die nicht unbedingt für die menschenwürdigsten Produktionsbedingungen in Bangladesh oder Brasilien bekannt sind – erfolglos. Stattdessen ließ sich Fair Fashion finden: „Nachhaltige Hoodies“ aus recycelten Materialien, Hosen aus Bio-Baumwolle oder Fair-Trade-Shirts wie zum Beispiel von Armedangels.

Screenshot Fairnopoly
Fairmondo wollte aber laut eigener Aussage „ein Marktplatz für alle“ sein, auf der jeder neue, aber auch gebrauchte Produkte anbieten kann. Und siehe da, bei unserer Artikelsuche stießen wir ebenfalls auf eine XBOX. Die Spielkonsole von Microsoft steht weder für faire noch umweltfreundliche Herstellungsbedingungen. Unternehmenssprecherin Ulrike Pehlgrimm legte im Interview mit DER FREITAG dar, weshalb so etwas nicht auszuschließen sei und sogar zum Unternehmenskonzept passe: „Mit Fairnopoly wollen wir Nachhaltigkeit fördern. Wenn du also Deine gebrauchte Spielekonsole verkaufst, dann muss sich dein Käufer keine neue Konsole kaufen, sondern verwendet einen immer noch funktionierenden Artikel weiter. Du arbeitest damit ressourcenschonend“.
Weil aber vielleicht doch ein Rest an schlechtem Gewissen mitspielt – oder weil man eben konsequent weiterdenkt – gingen 1% der Verkaufsgebühr an Transparency Deutschland. Dieses „1% für eine faire Welt“ fiel bei jeder Transaktion an und wurde nach Unternehmensangaben an Initiativen, die sich für Transparenz und gegen Korruption einsetzen, gespendet.
Bei erneutem Suchen auf der Plattform im Jahr 2017 fanden wir wieder die obligatorische XBOX, und auch jede Menge offensichtlich nicht fair gehandelter Kleidung. Für all diese Produkte wurde weiterhin 1% vom Verkauf an Transparency Deutschland gespendet. Immerhin konnte man nun die Produktsuche aktiv nach den Kriterien „fair“ und „öko“ einschränken. Toll war auch die Kategorie „klein & edel“ – in der sich Liebhaberprodukte kleiner Labels fanden.
5. Was für Fairmondo als fairen Marktplatz sprach
Was genau zeichnete Fairmondo in den guten Jahren nun als fairen Marktplatz aus? Die Gründer hatten sich eine Menge einfallen lassen, um sich wirklich von Amazon & Co. abzuheben.
Vorteile für Anbieter
Fairmondo war zwar kein Nischenmarktplatz, wollte aber dennoch mit einem hohen Anteil an fairen Produkten aufwarten. Daher genoßen Anbieter von Produkten, die unter ökologischen oder sozial korrekten Bedingungen hergestellt wurden, gewisse Vorteile. Für faire Artikel fiel deutlich weniger von der sonst üblichen Verkaufsprovision an. Was Fairmondo genau unter „fair“ oder „öko“ verstand, war in den FAQs auf der Website nachzulesen.
Verkaufte man auf Fairmondo hingegen normale Produkte, die weder fair noch bio sind, dann kam man dennoch ein stückweit seiner unternehmerischen Verantwortung nach. Denn von von jedem Verkauf wurde ein „faires Prozent“ an Transparency Deutschland gespendet – eine Organisation, die Initiativen zur Korruptionsbekämpfung unterstützt. Damit sollte nicht nur ein theoretisches Signal gesendet, sondern aktiv gegen Missstände vorgegangen werden.
Vorteile für den Konsumenten
Für den Konsumenten bot Fairmondo eine Plattform, auf der man aktiv nach fairen und ökologischen Produkten stöbern konnte. Ein Bio-Spülmittel? Faire Kleidung? Oder Schokolade aus fairem Handel? All das und mehr fand man hier und konnte mit wirklich gutem Gewissen einkaufen. Obendrein spendete man ein „faires Prozent“ und trug damit zum veranwortungsvollen Wirtschaften bei. Obendrein konnte man auf Fairmondo gebauchte Dinge untereinander tauschen, handeln oder verschenken – was einer nachhaltigen Ressourcenverwendung entspricht. Den man muss nicht immer alles neu kaufen – z.B. Vintage Mode ist gefragter denn je! Und ein Retro Möbelstück kann ein echtes Schätzchen im Wohnzimmer sein.
Transparenz auf allen Ebenen
Ein wichtiges Kriterium, mit dem sich Fairmondo von der Konkurrenz abheben wollte, ist das Versprechen der Transparenz. So wurden auf der Homepage alle Kontobewegungen – selbstverständlich aus Datenschutzgründen anonymisiert – öffentlich gemacht. Die Beweggründe für diese maximale Offenheit? Durch die Kommunikation von Erfolgen, aber auch Problemen, wollten die Gründer Vertrauen schaffen, wie Felix Weth zu Beginn des Live-Gangs der Plattform im Interview mit Gründerszene verriet.
„Uns geht es nicht darum, jemanden mit dem Unternehmen reich zu machen. Wir wollen eine transparente und unabhängige Alternative zu den Großen sein“, sagte Unternehmensgründer Felix Weth zu Gründerszene. Es schien also tatsächlich eine Herzensangelegenheit gewesen zu sein, eine faire Wirtschaft möglich und ökonomisch zu machen. Wenn die Interessen eines Unternehmens nicht von wenigen großen Gesellschaftern, sondern einer Vielzahl an Genossenschaftern bestimmt werden, dann war das für Weth ein demokratisches Modell mit Zukunft.
6. Fairmondo in der Krise? Namenswechsel und Rationalisierung
Seit der Gründung hat sich einiges getan im Hause Fairmondo. Wie bei vielen Startups üblich musste das ein und andere Problem bewältigt werden, bevor man mit neuer Energie durchstarten konnte.
Aus Fairnopoly wurde Fairmondo
Der alte Name „Fairnopoly“ – mit dem man 2012 an den Start ging – kam nicht von ungefähr. Auf der Website war zu lesen, wie es zur Namensfindung in Anlehnung an das Brettspiel „Monopoly“ kam:
Was wir im Kern kritisieren, ist die Art des Wirtschaftens, für die dieses Spiel weltweit symbolisch steht. Fairnopoly steht für die Aussage, dass wir nicht länger in einer Welt leben möchten, in der der Großteil der Wirtschaft auf Profit auf Kosten anderer ausgerichtet ist.
Dass dies den Machern von Monopoly nicht passte, kann man sich vorstellen. Prompt flatterte kurz nach der Unternehmensgründung die Unterlassungserklärung einer internationalen Rechtsanwaltskanzlei ins Haus. Der Rechtsstreit mit dem Spielehersteller Hasbro um den Markennamen führte letztlich dazu, dass man sich Ende 2014 in „Fairmondo“ umbenannte. Ein ebenfalls schöner Name, wie wir finden – der für eine faire Welt steht.
Der Gürtel wird enger geschnallt
Was so schön begann, musste sich 2014 einem harten Gegenwind stellen. Nachdem die erste Crowdfunding-Kampagne gut gelaufen war und die Idee von Fairmondo ein großes Medienecho erfuhr, kehrte erst einmal Ernüchterung ein. Das StartUp musste einem Großteil seiner Angestellten kündigen, die schon eine Weile vorher teilweise nicht mehr bezahlt werden konnten. Die Einkünfte aus dem Marktplatz waren nicht wie erhofft eingetroffen und auch der Markenstreit mit Hasbro drückte auf die Finanzen.
Nur noch zwei fest angestellte Mitarbeiter konnte sich Fairmondo Ende 2014 mit Hilfe einer Förderung noch leisten. Der Rest musste gehen oder arbeitet unentgeltlich. „Wir 12 verbleibenden Teammitglieder sind uns der aktuellen Situation sehr bewusst. Einige haben sich trotz unklarer Bezahlungsaussicht dafür entschieden, andere Optionen auszuschlagen, um sich in dieser wichtigen Phase voll unser Unternehmen zu konzentrieren“, kommuniziert Felix Weth im damaligen Fairnopoly-Blog.

Bei einer zweiten Crowdfunding-Kampagne (siehe Grafik links von Fairnopoly) wurden die anvisierte halbe Million nicht erreicht, jedoch die nötige Schwelle von 125.000 Euro überschritten. Damit galt die Kampagne als erfolgreich.
Daraufhin hoffte Fairmondo auf möglichst viele Anteilszeichner, um die als „utopisch“ verschriene Idee zu einem rentablen Unternehmensmodell auszubauen. Per Video (siehe unten) rief man zum Genossenschaftsbeitritt auf. „Dreh das Spiel um“, so lautete das Motto noch unter dem Namen Fairnopoly. Blieb zu hoffen, dass auch das Unternehmen die Situation wieder umdrehen und mit Rückenwind am Unternehmensausbau arbeiten konnte. Und hat Fairmondo das geschafft?
Waren es 2014 noch 1.000 Mitglieder in der Genossenschaft, konnte die Zahl bis Mitte 2017 auf 2.000 Mitglieder verdoppelt werden. Ein Wachstum, das vielleicht nicht dem eines Riesen wie Amazon entsprach. Aber dem eines nachhaltig arbeitenden Startups, das sich langsam eine treue Fangemeinde aufbaut. Der Fokus lag auf fairen, nachhaltigen Produkte – inklusive echter Innovationen wie dem Fairphone.
Stand 2025: Fairmondo hat leider nicht überlebt
Wer heute nach „Fairmondo“ sucht, findet eine alte Facebookseite, auf der seit 2020 nichts mehr passiert ist, sowie einen gleichnamigen Bioladen in der Schweiz, der mit der Fairmondo e.G. allerdings gar nichts zu tun hat. Die Website: offline. Im Handelsregister: Ein Insolvenzeintrag und die Löschung der Genossenschaft.
Zu all dem gab keine großen Presse-News. Heimlich, still, und leise verschwand Fairmondo 2024 in der Versenkung und meldete offenbar endgültig die Geschäftsaufgabe an. Letztlich kann über die Gründe nur spekuliert werden – doch schon die Jahre zuvor schienen sich arge Finanzierungsprobleme abzuzeichnen. Zudem wies uns ein aufmerksamer Leser darauf hin, dass (Zitat) „(…) Genossenschaftsmitglieder um ihr zur Verfügung gestelltes Geld gebracht wurden.“ Es ist mehr als schade, dass sich dieses in der Theorie sehr gute Konzept nicht am Markt durchsetzen konnte.
Titelbild: Fairmondo
Christian ist Kaffeeblogger seit 2008, leiderschaftlicher Home-Barista und Gründer und Geschäftsführer der Happy Coffee GmbH. Seit 2015 liefert er jeden Monat über den Online-Shop frisch gerösteten Kaffee aus fairem Direkthandel an tausende Kunden. Sein tiefgreifendes Wissen über Kaffee teilt er regelmäßig hier im Blog.